Sommerhitze 2004: Energieeffizienz und Schutz durch massives Mauerwerk
 (30.4.2004) Wie lässt sich bei hochsommerlichen
Außentemperaturen ein angenehmes Raumklima sicherstellen? Wie stark beeinflussen
die eingesetzten Baumaterialien und ihre speziellen Materialeigenschaften den
sommerlichen Wärmeschutz in Wohn- und Arbeitsräumen?
(30.4.2004) Wie lässt sich bei hochsommerlichen
Außentemperaturen ein angenehmes Raumklima sicherstellen? Wie stark beeinflussen
die eingesetzten Baumaterialien und ihre speziellen Materialeigenschaften den
sommerlichen Wärmeschutz in Wohn- und Arbeitsräumen?
Ein guter sommerlicher Hitzeschutz hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Grundlegend wichtig sind Größe, Orientierung sowie Neigung der Fensterflächen, die durch ausreichend dimensionierte Verschattungseinrichtungen von außen geschützt werden müssen. Räume sollten ausreichend in den Abend- bzw. Nachtstunden gelüftet werden. Vorteilhaft ist es zudem, wärmespeichernde Materialien zu verwenden. Dies trifft insbesondere für Wandbaustoffe zu, die ausreichend schwer sind, weil sich ihre massive Wärmespeicherfähigkeit positiv auf das sommerliche Temperaturverhalten eines Gebäudes auswirkt: So entzieht beispielsweise der natürliche Wärmespeicher Kalksandstein der Raumluft überschüssige Wärme und speichert sie. Er reduziert auf diese Weise die maximale Innenraumtemperatur und sorgt selbst im Hochsommer für mehr Wohn- und Arbeitsplatzqualität in einem angenehmen Raumklima.
Besonders gut lässt sich dieser Effekt nutzen, wenn durch Lüftung während der kühleren Nachtstunden die wärmespeichernde Wand "entladen" wird. Tagsüber kann die KS-Wand der Raumluft dann wieder große Wärmemengen entziehen und speichern. Diese Wirkung entspricht der einer natürlichen Klimaanlage.
Es habe sich laut Kalksandstein-Lobby bestätigt, dass massive, schlanke KS-Konstruktionen im Vergleich zu leichteren monolithischen Wandbaustoffen wie Porenbeton oder Ziegel und insbesondere gegenüber Holzbaukonstruktionen für niedrigere maximale Raumtemperaturen sorgen [1] gerade während großer sommerlicher Hitzeperioden. Wesentlichen Einfluss hat die Höhe der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit (Cwirk). Sie gibt an, wie viel Wärme ein Bauteil pro m² speichern kann. Je größer der Wert, desto mehr Wärme kann die Wand der Raumluft entziehen und desto geringer, angenehmer sind die auftretenden Raumlufttemperaturen.
Die Wärmespeicherfähigkeit von Bauteilen erfolgt allerdings nur bis zu einer Wanddicke von maximal 10 cm Zentimetern. Deshalb nutzen schlanke KS-Wände - bedingt durch ihre Rohdichte - die Wärmespeicherfähigkeit nahezu optimal. Im Vergleich dazu können dicke monolithische Außenwände die Wärmespeicherfähigkeit nur in den Randbereichen (10 cm) ausnutzen und "verlieren" dadurch Wohn- bzw. Nutzfläche. Aufgrund der hohen Rohdichten ermöglichen schlanke KS-Wände zudem einen hervorragenden Schallschutz. Resonanzeffekte, die den Schallschutz deutlich verschlechtern (wie etwa bei dicken Lochsteinen) treten bei KS-Konstruktionen nicht auf.
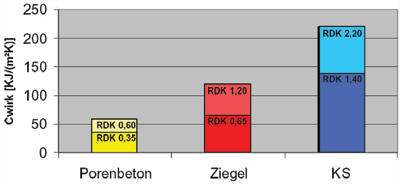
Die wärmespeichernden Vorteile von KS sind sogar in der Normung berücksichtigt. Mit Neufassung von DIN 4108-2 (Erscheinungsdatum: April 2003) werden massive Konstruktionen nicht mehr pauschal als "schwere Bauart" eingestuft; eine differenzierte Betrachtungsweise ist seitdem erforderlich: Soll die Bonusregelung für schwere Bauweise in Anspruch genommen werden, ist der zusätzliche Nachweis der vorhandenen Wärmespeicherfähigkeit (Cwirk/Ag) vorzunehmen. Bei Ausführung reiner KS-Konstruktionen (Rohdichteklasse 1,8, Verwendung von massiven Stahlbetondecken) im Wohnungsbau kann dieser Bonus grundsätzlich ohne weiteren Nachweis in Anspruch genommen werden. Der maßgebliche Grenzwert wird in diesen Fällen sicher erreicht [2].
Auf der KS-Website wird unter www.kalksandstein.de ein neues kostenfreies Nachweisprogramm zum sommerlichen Wärmeschutz zum Download angeboten. Neben ausführlichen Informationen wird das neue Nachweisverfahren auch anhand eines anschaulich dokumentierten Beispiels erläutert. Eine farbige Klimakarte zeigt die neue Klimazonen-Einteilung für die Bundesrepublik. Vorbereitete Tabellenblätter unterstützen bei der Massenermittlung und dem aufwendigen Nachweis der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit zur Einstufung in Bauteilklassen. Der eigentliche Nachweis kann mit einem vorbereiteten Tabellenblatt schnell und sicher geführt werden. Die aussagefähigen Ergebnisausdrucke können den Planungsunterlagen beigelegt werden.
| ______ | |
| [1] | Prof. Dr.-Ing. Werner: Untersuchung über den notwendigen sommerlichen Wärmeschutz nach DIN 4108-2 bei verschieden schweren Baukonstruktionen eines Einfamilienhauses, Juni 2002 |
| [2] | Prof. Dr.-Ing. Hauser und Dr.-Ing. Maas: Energieeinsparverordnung 2002 (EnEV), 2. Auflage November 2002, Herausgeber: KS-Info GmbH, Hannover |
siehe auch:
- Thermische Speicher aus Kalksandstein im Baukompetenzzentrum Ruhr (27.9.2010)
- Neuer Silka-Ytong-Referenzwettbewerb (12.7.2009)
- "Ohne Forschung hat der Baustoff Ziegel keine Zukunft". (16.7.2004)
- Sommerlicher Wärmeschutz mit Beton (4.7.2004)
- Kalksandsteine im XL-Format für mehr Wirtschaftlichkeit am Bau (21.6.2004)
- weitere Details...
ausgewählte weitere Meldungen:
- T12: Neuer Wärmedämm-Planziegel für den Objektbau - Flächengewinn inbegriffen (19.4.2004)
- KS-Funktionswand - Beispiel Schallschutz (14.4.2004)
- Ziegelfassaden: mit Jahrhundertsommer kein Problem (5.3.2004)
- Das Porenbeton-Bausystem - neue Produkte und Konzepte (11.8.2003)
- Sommerlicher Hitzestau!? Damit die Wohnung nicht zur Sauna wird (13.6.2003)
siehe zudem:
- Literatur / Bücher zu den Themen Mauerwerksbau, Bauen bei Amazon - konkret z.B.:
- DIN Recherche nach Normen und Verlagsartikeln - Stichwort: "Mauerwerk"
- Wände • Dämmen • Wärmedämm-Verbundsysteme bei Baulinks