Nach dem Hochwasser: Trinkwasser-Installationen trocknen, reinigen und spülen
(23.6.2013) Das verheerende „Jahrhundert-Hochwasser“ im Juni 2013 hat in weiten Teilen von Ostdeutschland, Niedersachsen und Bayern Tausende Häuser oft metertief unter Wasser gesetzt. Neben den materiellen Schäden drohen nun auch gesundheitliche Risiken, da verkeimtes Schmutzwasser über die Versorgungsleitung oder indirekt - zum Beispiel über Sicherungsarmaturen - mit der Trinkwasser-Installation in Berührung gekommen sein könnte. Sobald der Versorger wieder einwandfreies Wasser zur Verfügung stellt, sollten die Trinkwasser-Installationen komplett gesäubert und unbedingt durchgespült werden. In Gebäuden mit Risikopatienten wie beispielsweise Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern und bei Verdacht einer Keimbelastung ist das Wasser außerdem in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weitergehend zu untersuchen. Darüber hinaus besteht die Gefahr von Korrosionsschäden.
Die Qualität des Trinkwassers, wie es die Versorger bereitstellen, entspricht üblicherweise höchstem Niveau. Durch das Hochwasser sind aber massive Verschmutzungen aus Kläranlagen und Kanälen sowie verkeimtes Oberflächenwasser an und in die Trinkwasser-Installationen der Häuser gelangt. Das birgt Risiken:
- Trinkwasserberührte Oberflächen sind mit Krankheitserregern kontaminiert.
- Schmutz und Partikel gefährden technische Bauteile und führen zu Innenkorrosion.
- Dauerhaft durchfeuchtete Dämmungen (z.B. von Rohrleitungen oder Armaturen) verursachen auf Zeit Lochkorrosion.
Möglichst schnell handeln
In einer ersten Sofortmaßnahme sollte daher schon bei den Aufräumarbeiten die durchfeuchtete Dämmung aller Rohrleitungssysteme entfernt und entsorgt werden. Der Hintergrund: Da heutige Dämmungen geschlossenporig sind, würden sie auch nach Wochen nicht trocknen. Das führt bei metallenen Bauteilen wie Rohren, Verbindern oder Armaturen sowie bei verzinkten Stahlrohren (so genanntem C-Stahl für Heizungsinstallationen) schnell zu Schäden durch Außenkorrosion. Aber auch bei deutlich robusteren Materialien wie Kupfer, Rotguss oder Edelstahl ist die Dämmung allein schon wegen der unbekannten Wasserzusammensetzung unbedingt zu entfernen.
Als weitere Maßnahme ist die gesamte Installation außerdem möglichst schnell von außen gründlich zu säubern. Zumindest für die Endreinigung gilt: nur einwandfreies Trinkwasser einsetzen! Ob die Wasserqualität bereits wieder diesen Anspruch erfüllt, lässt sich durch eine kurze Rückfrage beim Versorger klären. Herrscht Unklarheit über die mikrobiologische Beschaffenheit eines ansonsten sauberen und geruchsfreien Wassers in der Installation, kann es vorsorglich abgekocht werden. Im Zweifelsfall sollte aber niemand ein Risiko eingehen und sich bei gesundheitlichen Fragestellungen an die lokale Gesundheitsbehörde sowie den Wasserversorger und bei technisch-fachlichen Fragestellungen rund um die Installationen im Haus immer an den Fachhandwerker wenden.
Regelwerke von DVGW und ZVSHK beachten
Für die weitergehenden Arbeiten zum Erhalt der Trinkwassergüte in überfluteten Installationen gelten vor allem ...
- das DVGW-Arbeitsblatt W 557 „Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser-Installationen“ (Okt. 2012) sowie
- die ZVSHK-Merkblätter „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen“ bzw. „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen“.
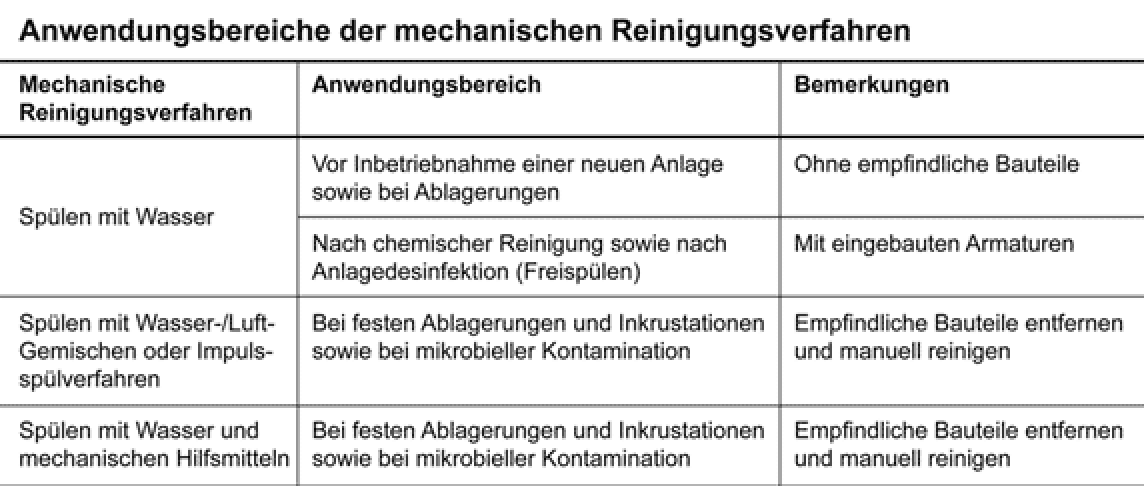
Nur bei Einhaltung der hier beschriebenen Maßnahmen ist gewährleistet, dass belastete Anlagen schnell und effizient Trinkwasser wieder in der gewohnt hohen Qualität liefern – und sämtliche Installationskomponenten ebenfalls wieder einwandfrei funktionieren. Wie dabei im Einzelnen vorzugehen ist, hängt von der individuellen Situation ab:
-
Generell gilt: Ist bereits das Trinkwasser der Versorgungs- und Hausanschlussleitung verschmutzt, muss mit der Spülung der häuslichen Trinkwasserinstallation gewartet werden, bis der Versorger wieder einwandfreies Trinkwasser bereitstellt.
-
„Halbfertige“ Trinkwasser-Installationen, die beispielsweise in einem Roh- oder Neubau geflutet wurden, sind so zu verschließen, dass sie entsprechend den Regelwerken von ZVSHK und DVGW mit einem Wasser-/Luft-Gemisch gespült und gereinigt werden können (siehe Tabelle 1). Möglicherweise müssen komplexe Installationen dafür in kleinere Einheiten unterteilt werden. Befindet sich die Trinkwasser-Installation in einem Objekt mit hohen hygienischen Anforderungen (z.B. Alten- und Pflegeheim, Krankenhaus), empfiehlt sich eine anschließende mikrobiologische Untersuchung.
Werden bei den anschließenden Installationsarbeiten Komponenten aus überfluteten Lagern weiter verwendet, sind diese ebenfalls sehr sorgfältig zu spülen – auch wenn sie zuvor schon einmal gereinigt worden sind. Bei der Verwendung von gereinigten Installationskomponenten sollte zumindest im ersten Objekt eine orientierende Wasseruntersuchung (siebe Tabelle 2) durchgeführt werden. Sie gibt die notwendigen Informationen, wie erfolgreich die Reinigung der Lagerware aus hygienischer Sicht war.
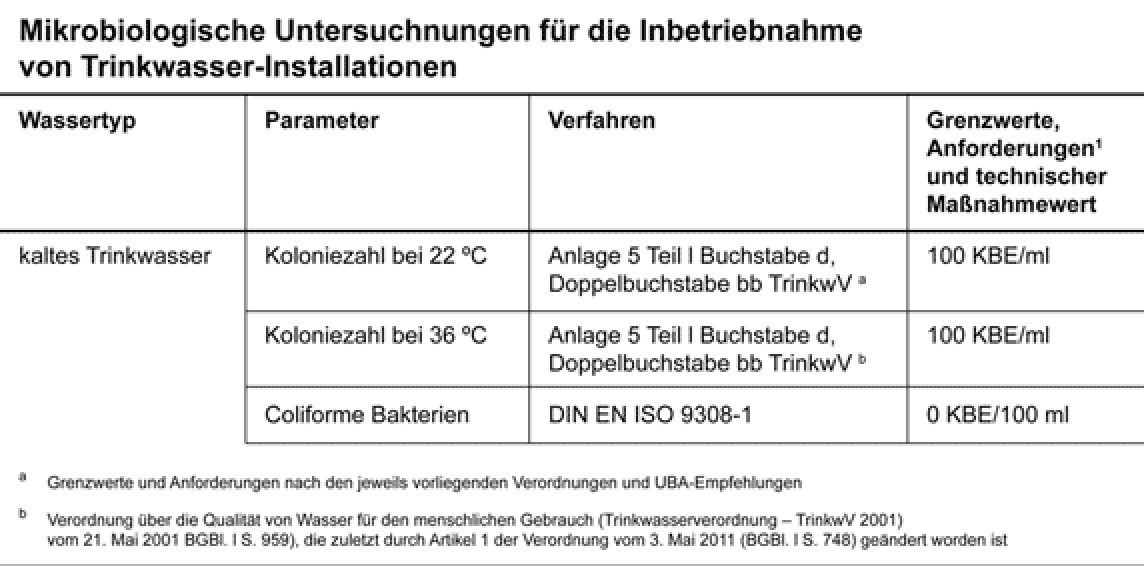
-
„Geschlossene“ Trinkwasser-Installationen in bestehenden Gebäuden sollten erst wieder benutzt werden, wenn eine Reinigung und Spülung durchgeführt worden ist. Vor der Spülung wird die Anlage im ersten Schritt nach unten komplett entleert und sofort wieder mit Trinkwasser gefüllt. So werden lokale Kontaminationen aus dem Kellerbereich nicht im gesamten Gebäude verteilt. Im zweiten Schritt ist gegebenenfalls eine Dichtheitsprüfung notwendig, wenn Beschädigungen an Rohrleitungen oder Armaturen vermutet werden, beispielsweise durch aufschwimmende Gegenstände während der Flutung. Der abschließende Spülprozess erfolgt dann gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 557 - siehe Tabelle 3:
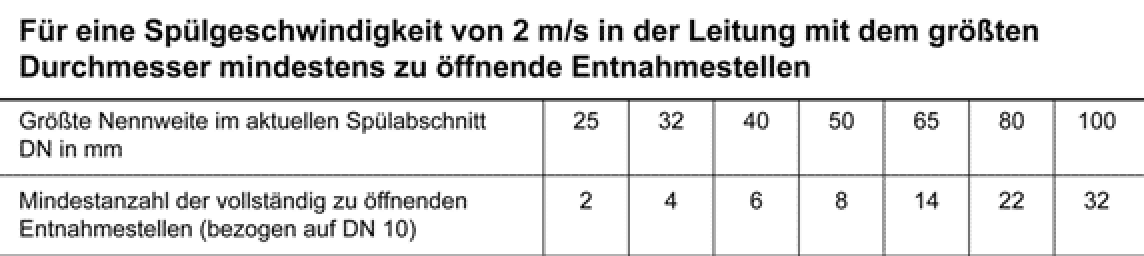
Im Zweifel beproben
In den meisten Fällen ist die fachgerechte Spülung bestehender Trinkwasser-Installationen möglichst mit einem Wasser-/Luftgemisch völlig ausreichend, um nach dem Hochwasser die Trinkwassergüte wiederherzustellen. Bestehen allerdings Restzweifel oder ein erhöhtes Schutzziel wie in Kindergärten, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen, sollte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Beprobung durchgeführt werden. Als Orientierung gelten dabei die mikrobiologischen Grenzwerte für “Allgemeine Bakterien” und für “Coliforme Bakterien” als Indikator einer fäkalen Verunreinigung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 557, Tabelle 4. (siehe Tabelle 2). Eine weitergehende Untersuchung auf Legionellen ist nicht notwendig, auf Pseudomonaden nur bei besonderen Fragestellungen, da diese beiden Bakterientypen im Hochwasser keine geeigneten Lebensbedingungen vorfinden. Das haben Untersuchungen nach dem ähnlich verheerenden Hochwasser im Jahre 2002 bestätigt.
Werden bei der Beprobung Auffälligkeiten festgestellt, ist die Trinkwasser-Installation mit einem Wasser-/Luft-Gemisch gemäß den Regelwerken von ZVSHK und DVGW nochmals zu spülen.
Nur im Ausnahmefall desinfizieren
Erst wenn trotz fachgerechter Reinigungs- und Spülmaßnahmen die Keimbelastung immer noch über den Grenzwerten liegt, ist eine Desinfektion der Trinkwasser-Installation notwendig: Chemische Desinfektionen belasten generell die Rohrwerkstoffe und die sonstigen Komponenten in der Installation, sollten also möglichst selten eingesetzt werden (vgl. W 557). Hinzu kommt, dass erfolglose Reinigungs- und vor allem Desinfektionsmaßnahmen immer auch nicht erfasste Kontaminationsquellen anzeigen! Vor einem erneuten Desinfektionsversuch muss also zunächst diese Quelle gefunden und beseitigt werden.
Um die Installation bei der Desinfektion der Anlage nicht unnötig zu belasten, ist auf die Grenzwerte zu Konzentration und Einwirkzeit der Wirkstoffe nach DVGW-A W 557 zu achten - siehe Tabelle 4:
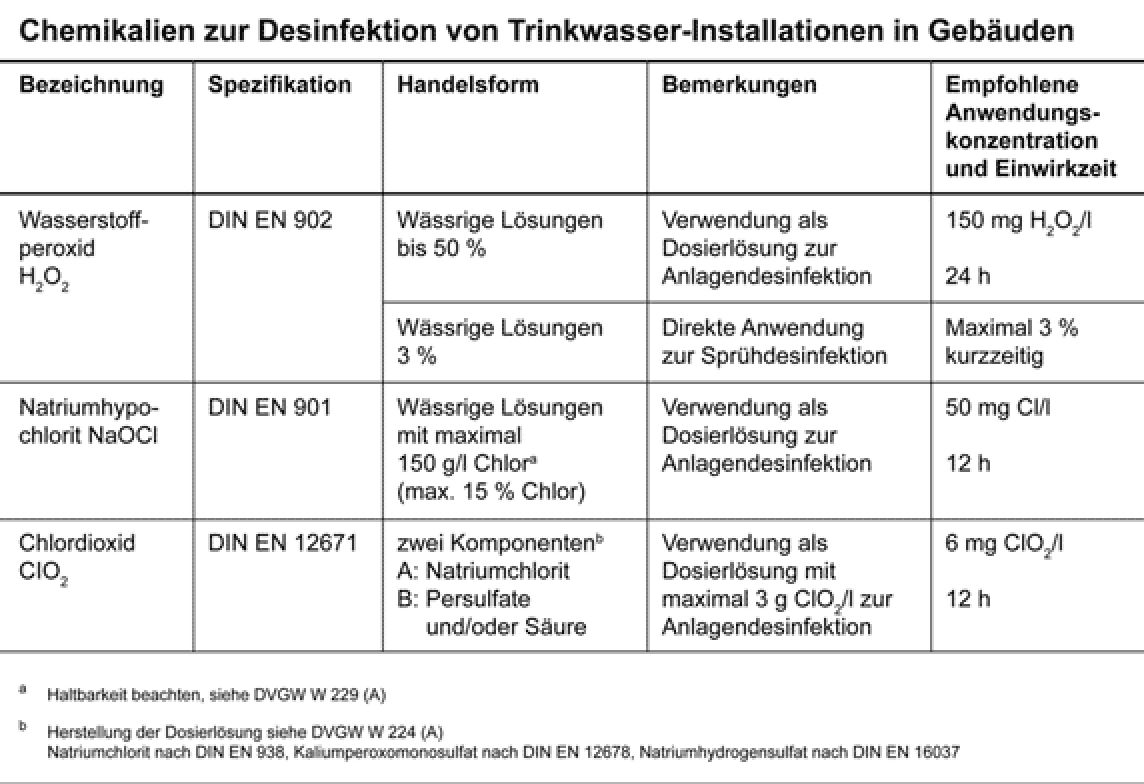
für Handel und Handwerk: Auch Warenlager überprüfen!
Das „Jahrhundert-Hochwasser“ hat nicht nur Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen überflutet, sondern auch unzählige Industrie- und Gewerbebetriebe und ihre Lager. SHK-Fachhandwerker sollten die Installationskomponenten aus überschwemmten Warenlagern oder Werkstattwagen keinesfalls ungeprüft weiter verwenden: Verkeimtes Schmutzwasser kann sogar in Beutelverpackungen oder abgestopften Rohren eingedrungen sein! Die Produkte würden also später die Installation, in der sie verbaut werden, kontaminieren.
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sollten daher bei Rohren und gegebenenfalls Verbindern die Stopfen entfernt, die Produkte mit einwandfreiem Trinkwasser durchgespült und dann zügig getrocknet werden (Rohre mit Gefälle lagern!). Das gleiche gilt für Installationskomponenten aus nassen Beutelverpackungen oder durchfeuchteten Kartons. Grundsätzlich dürfen keine Ablagerungen in den Produkten verbleiben, da sie unter anderem Wasser länger binden würden - und Bakterien darin weiter leben könnten. Zusätzlich ist eine Sichtkontrolle auf weitergehende Beschädigungen notwendig.
In den meisten Fällen reichen diese Maßnahmen bereits aus, weite Teile des Materialbestandes zu retten. Die chemische Desinfektion einzelner Komponenten ist dagegen in aller Regel nicht zielführend, da Aufwand und Belastung des Materials in keinem Verhältnis zum Ergebnis stehen. Im Einzelfall ist dann eher die Entsorgung des gefluteten Bauteils die sinnvollste Lösung.
Ähnliches gilt für komplexe Installationskomponenten, wie spezielle Sicherungsarmaturen oder elektronisch gesteuerte Armaturen und Bauteile. Sind die erkennbar nass oder sogar in Mitleidenschaft gezogen, empfiehlt sich eine Nachfrage beim Hersteller. Ist die qualifizierte Reinigung dann nicht möglich oder sinnvoll, dürfen auch diese Komponenten nicht weiter verwendet werden.
siehe auch für zusätzliche Informationen:
- Neue BBSR-Broschüre zum Hochwasserschutz für Gebäude, Kommunen und Regionen (9.11.2014)
- „Forum GMS“: Sanitärbranche zur UBA-Hygieneliste und Werkstoff-Alternativen (17.7.2014)
- Aqcuarin: Neue Trinkwasserlegierung mit hoher Entzinkungsbeständigkeit (17.7.2014)
- Nachrüstlösung zur Überwachung der Trinkwassergüte: „Schell Probfix“ (17.7.2014)
- Neuausrichtung der nunmehr GTGA - Güte- und Überwachungsgemeinschaft Technische Gebäudeausrüstung (2.3.2014)
- weitere Details...
ausgewählte weitere Meldungen:
- Kleine Liste mit Aktionsangeboten wegen des Mai/Juni-Hochwassers 2013
- Elektrosicherheit bei Hochwasser und nach Abzug des Wassers (23.6.2013)
- Zweiteiliger Schwenk-Leitfaden zur Behebung von Hochwasserschäden an Wänden (23.6.2013)
- Hochwasser-Set mit Wärmebildkamera, Materialfeuchte-Messgerät, Funkfeuchte-Fühler (18.6.2013)
- TÜV: Risiken bei Solaranlagen, wenn das Wasser nach einem Hochwasser sinkt (11.6.2013)
- Fachbuchvorstellung: „Richtig handeln bei Wasser- und Feuchtigkeitsschäden“ (11.6.2013)
- „Handbuch der Bauwerkstrocknung“ in 3. Auflage vom Fraunhofer IRB-Verlag (11.6.2013)
- 30 Jahre Missel Dämmpass: 36. Auflage stellt alle relevanten Neuerungen anschaulich dar (10.6.2013)
- Hygienisch geeignete Sanitärwerkstoffe gemäß aktueller UBA-Liste (23.4.2013)
- „Die ganze Welt der Trinkwasserhygiene“ im neuen Praxisratgeber von Honeywell (23.4.2013)
- HyTwin: Neues Hygiene-System von Schell und Kemper verhindert Stagnation in Trinkwasserleitungen (22.3.2013)
- Leicht nachrüstbares, optimiertes Easytop-Probenahmeventil mit Sanpress-T-Stück (22.3.2013)
- Überarbeitete Trinkwasserverordnung: Was ist wann von wem zu tun? (10.1.2013)
siehe zudem:
- Trinkwasserinstallation, Wasseraufbereitung, Armaturen und Sanitärtechnik sowie Hochwasserschutz auf Baulinks
- Literatur / Bücher zu den Themen Trinkwasser, Sanitärtechnik bei Baubuch / Amazon.de