Wenn Sockelanschluss, dann thermisch entkoppelt
Fachbeitrag von ...
- Dipl.-Phys. Gerhard Lude, Mitarbeiter im Ingenieurbüro ebök in Tübingen, Bereich Bauphysik, und
- Dipl.-Ing. Raimar Thiess, Marktmanager energieeffizientes Bauen bei der Knauf Gips KG und öbuv Sachverständiger für Wärmeschutz.
(19.9.2007) Wärmetechnische Berechnungen bestätigen es: die bauübliche Konstruktion eines Sockelanschlusses bei Wärmedämmverbundsystemen mit Aluminiumschiene stellt eine erhebliche Wärmebrücke dar. Gerade bei kleineren Gebäuden ist der Einfluss gravierend. Wärmebrückenfreie Lösungen, wie etwa Quix, bieten hier effektive Lösungen.

Die Tücken einer Wärmedämmung liegen meist im Detail. Billige Dämmmaterialien, fehlerhafte Anschlussdetails, Nichtbeachtung von Wärmebrücken oder gar unqualifiziertes Befestigen von Lampen oder Markisen - schon ist unnötiger Wärmeverlust vorprogrammiert. Schade eigentlich, mindert dies doch die so dringend benötigte Effizienz.
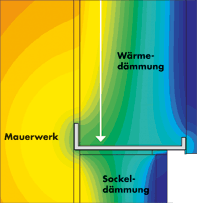 Ein
besonders krasses Beispiel hierfür kann der Sockelanschluss sein. Wird ein
Sockel ausgebildet, wofür es gute Gründe gibt, und liegt der Anschluss von
Wand- zu Perimeterdämmung im warmen Bereich (z.B. bei beheiztem Keller oder
hohem Sockel), so stellt die herkömmliche Ausführung der Systemanschlüsse (mit
Aluminiumprofilen ausgeführt) eine erhebliche Wärmebrücke dar. Die Schiene
durchdringt die Wärmedämmung auf voller Länge des Anschlusses (siehe Bild
rechts) Aluminium ist einer der besten technischen Wärmeleiter
überhaupt. Es leitet Wärme rund 4000 mal besser als gebräuchliche Dämmstoffe.
So wird unmittelbar klar, dass auch dünne Bleche hohe Wärmeverluste
hervorrufen können.
Ein
besonders krasses Beispiel hierfür kann der Sockelanschluss sein. Wird ein
Sockel ausgebildet, wofür es gute Gründe gibt, und liegt der Anschluss von
Wand- zu Perimeterdämmung im warmen Bereich (z.B. bei beheiztem Keller oder
hohem Sockel), so stellt die herkömmliche Ausführung der Systemanschlüsse (mit
Aluminiumprofilen ausgeführt) eine erhebliche Wärmebrücke dar. Die Schiene
durchdringt die Wärmedämmung auf voller Länge des Anschlusses (siehe Bild
rechts) Aluminium ist einer der besten technischen Wärmeleiter
überhaupt. Es leitet Wärme rund 4000 mal besser als gebräuchliche Dämmstoffe.
So wird unmittelbar klar, dass auch dünne Bleche hohe Wärmeverluste
hervorrufen können.
Betrachtet man beispielsweise ein typisches Einfamilienhaus aus den 50er Jahren mit warmen Keller, dessen Außenwände mit 140 mm und dessen Kellerwand und Sockel mit 80 mm Dämmstoff (jeweils λ = 0,035 W/mK) gedämmt sein sollen. Der Anschluss mittels Aluminiumprofils erfolgt auf Höhe der Geschossdecke oder höher, er liegt folglich im warmen Bereich. In diesem Beispiel betragen die Wärmeverluste, verursacht durch die Metallschiene bereits mehr als 40% der gesamten Wärmeverluste der Außenwand. Oder anders ausgedrückt: Rechnet man diesen Verlust auf die tatsächlich wirksame Dämmstoffdicke der Außenwand um, so beträgt die wirksame Dämmstoffdicke statt 140 mm nur noch ca. 90 mm - siehe in der folgenden Thermograhie der rote Streifen, der quer durchs Bild läuft:

Solch hohe Wärmeverluste sind bitter, aber es kann noch schlimmer kommen. Stellt die Alu-Sockelschiene unter Norm-Bedingungen kein bauphysikalisches Problem dar, so kann unter ungünstigen Randbedingungen Schimmelpilzwachstum begünstigt werden. Diese Gefahr droht bereits, wenn sich in Küchen, Bädern oder Schlafzimmern Möbel direkt an der Wand befinden. Insbesondere durch Einbauschränke wird die Luftzirkulation stark behindert, weshalb die Wand dort kälter ist als an frei zugänglichen Stellen. Durch die Alu-Sockelschiene kann es an diesen Stellen der Wand so kalt werden, dass Schimmel entsteht. Vielleicht sollte man besser nicht hinter jeden Einbauschrank schauen ...
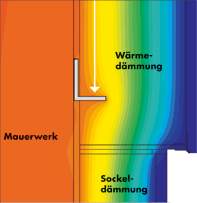 Die Lösung der Probleme liegt in der thermischen Entkopplung.
Knauf Marmorit (jetzt Knauf Gips) hat hierfür Quix entwickelt - ein thermisch entkoppeltes
Sockelanschlusselement, das ohne metallische Durchdringung auskommt. Es besteht
aus einem Polystyrol (oder einem Mineralfaserkern), einer ober- und unterseitigen
Abschlussplatte aus geschäumtem mineralischem Werkstoff und einem Kantenprofil.
Das Element wird entlang des Schnurschlags mit Klebemörtel auf die Wand geklebt
und bildet somit bereits eine saubere, schnurgerade untere Dämmstoffreihe, auf
die problemlos aufgebaut werden kann. Der im Eingangsbild oben und im rechten
Bild sichtbare Metallwinkel
wird lediglich als Montagehilfe eingesetzt, sie durchdringen die Wärmedämmung
nicht. Dadurch reduziert sich die Wärmebrückenwirkung auf einen
vernachlässigbaren Wert: Quix ist praktisch wärmebrückenfrei. Das Quix System
ist in Stärken von 60 bis 400 mm erhältlich und vom Passivhausinstitut Dr. Feist
als "passivhaustaugliche Komponente" zertifiziert (siehe auch
Thermograhie eines thermisch entkoppelten Sockels).
Die Lösung der Probleme liegt in der thermischen Entkopplung.
Knauf Marmorit (jetzt Knauf Gips) hat hierfür Quix entwickelt - ein thermisch entkoppeltes
Sockelanschlusselement, das ohne metallische Durchdringung auskommt. Es besteht
aus einem Polystyrol (oder einem Mineralfaserkern), einer ober- und unterseitigen
Abschlussplatte aus geschäumtem mineralischem Werkstoff und einem Kantenprofil.
Das Element wird entlang des Schnurschlags mit Klebemörtel auf die Wand geklebt
und bildet somit bereits eine saubere, schnurgerade untere Dämmstoffreihe, auf
die problemlos aufgebaut werden kann. Der im Eingangsbild oben und im rechten
Bild sichtbare Metallwinkel
wird lediglich als Montagehilfe eingesetzt, sie durchdringen die Wärmedämmung
nicht. Dadurch reduziert sich die Wärmebrückenwirkung auf einen
vernachlässigbaren Wert: Quix ist praktisch wärmebrückenfrei. Das Quix System
ist in Stärken von 60 bis 400 mm erhältlich und vom Passivhausinstitut Dr. Feist
als "passivhaustaugliche Komponente" zertifiziert (siehe auch
Thermograhie eines thermisch entkoppelten Sockels).
siehe auch für weitere Informationen:
- Knauf Gips KG
- ebök Ingenieurbüro für Energieberatung, Haustechnik und ökologische Konzepte GbR
- Passivhausinstitut
- Detaillierte Sockelausbildung von Ziegelwerk Bellenberg und Roland Wolf (8.10.2020)
- Xenergy, die neue XPS-Generation von Dow (13.7.2011)
- XPS-Hartschaumplatten mit Waffelstruktur für bessere Haftung (12.5.2011)
- Ceresit-Dämmstoffkleber für Perimeterdämmplatten in der Kellerabdichtung (11.5.2010)
- Vorteile für einzeln gefertigte EPS-Perimeterdämmplatten (22.2.2010)
- weitere Details...
ausgewählte weitere Meldungen:
-
Neu
stattauf Alt: Upgrade für die Fassadendämmung (19.9.2007) - Ideenkatalog: WDVS-Fassaden gestalterisch aufwerten (3.9.2007)
- Neues dena-Infopaket für Verbraucher: Effizientes Bauen und Sanieren von A bis Z (20.8.2007)
- Passiv Bauen auch im Altbau (8.8.2007)
- Trendstudie zur WDVS-Entwicklung bis 2012 (7.8.2007)
- Aktualisierte Ausgabe von "URSA EnEV kompakt" erschienen (6.8.2007)
- Neues Passivhaus Projektierungspaket 2007 (2.7.2007)
- BASF stellt vor: Vom 3-Liter-Haus zum Null-Heizkosten-Haus (2.7.2007)
- WDV-System für problematische Untergründe auch in Gelb (5.6.2007)
- Neues Jahrbuch Energieeffizienz in Gebäuden (28.5.2007)
- Weber Broutin stellt Resol-WDVS mit bemerkenswertem Wärmeleitwert vor (20.4.2007)
- Brillux lotet WDVS neu aus (20.4.2007)
- Caparol stärkt Fassade mit Karbonfasern (20.4.2007)
- Geklebt/gedübeltes WDV-System für problematische Untergründe (20.2.2007)
- Thermografie erleichtert Sanierungsplanung (21.6.2006)
siehe zudem:
- WDV-System, Dämmstoffe und Putzfassade auf Baulinks
- Literatur / Bücher zu den Themen Wärmedämmung und Niedrigenergiehaus bei Amazon